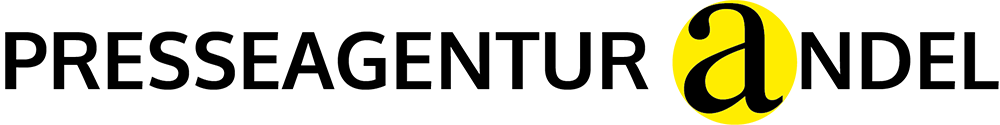Mit der Erfindung des Maybots landete der 68-jährige Autor vom britischen Guardian John Crace einen Glücksgriff. Er hatte den perfekten politischen Stereotypen entwickelt. Schema eines Homo Politicus, der seinem Volk nicht dient, sondern eher daneben existiert, es ausnimmt, beschuldigt und betrügt und dabei in einer Endlosschleife immer die gleichen Dinge von sich gibt. Dinge, die mit seinem Tun alles andere als im Einklang stehen.
Crace ist kein Kind von Traurigkeit. Hört man ihn in seinen Podcasts sprechen, vernimmt man die Stimme eines gebrochenen Mannes, der seine Vergangenheit gerade so überlebt zu haben scheint. Der ehemalige Heroinabhängige konnte sein altes von Drogen bestimmtes Leben aber überwinden und wurde zu einem der bekanntesten Autoren des Guardian, was nicht zuletzt seinen scharfzüngigen Bemerkungen zur ehemaligen Premierministerin Theresa May zu verdanken ist. Eine Frau, die selten mehr zu sagen hatte, als dass sie für ein „starkes und stabiles“ (strong and stable) Land stünde, was aber offenkundig niemand außer ihr erkennen konnte.
Da Frau May dennoch unablässig auf die Worte „strong and stable“ oder andere Worthülsen zurückfiel, kam Crace nicht umhin, sie mit einem „Bot“ zu vergleichen, also einem Programm, das ohne menschliches Zutun nur wenige Aufgaben verrichtet. Weil Theresa May mehr oder weniger genauso handelte, wurde der Maybot zum allseits beliebten Begriff ihrer Vorgehensweise. Sozusagen als Hommage an John Crace erlaubt sich der Verfasser dieser Zeilen nun die Übertragung des Maybot-Gedankens auf weitere Modelle des Wertewestens.

Da wäre beispielsweise der Merzbot. Wir kennen ihn seit der ersten Beta, sein Programmcode ist uralt. Er ist Produkt konservativer IT mit großem Nutzen für US-Konzerne, nicht jedoch europäische Anwender. Die im überhöhten Zynismustakt laufende Egoware soll Insidern zufolge seit Jahrzehnten in einer Endlosschleife laufen, sämtliche verfügbaren Ressourcen verbrauchen und nichts bewirken. Der Merzbot zeigt unaufhörlich Gefahren an, um den Anwender zunächst dazu zu verleiten, den Funktionsumfang des Betriebssystems zu verringern. Im Anschluss daran bietet er die kostenpflichtige Reaktivierung der verlorenen Funktionen an. Den Einbau einer Empathie-Engine hielten die Entwickler für unnötig. Version 69.5 des Merzbots wurde unlängst veröffentlicht und war das teuerste Update aller Zeiten. Der Merzbot läuft bei komplexen Sachverhalten nur mit single-tasking und unter Nutzung des gesamten Arbeitsspeichers. Unnütze Aktionen, wie die fortwährende Aufrüstung verfügbarer Hardware, versieht er mit höchster CDU-Priorität (Central Demagogic Unit = zentrale demagogische Einheit), scheitert mit seiner Rechenleistung aber schon an einfachsten sozialen Anforderungen.
Der französische Macronbot liegt uns in Version 47.4 vor und führte in internationalen Testlabors aufgrund der integrierten reichhaltigen Smiley-Erweiterung schon mehrfach zu einem Ausbruch von Heiterkeit. Die neokonservative Software dient ähnlich dem Merzbot vor allem der Abschreckung selbst erfundener Gefahren, kündigt oftmals große Aktionen an, belässt den Prozessor dann jedoch in Idle Time. Der Macronbot ist damit typisches Beispiel so genannter Vaporware und hat in seiner Laufzeitumgebung bislang zu keinen messbaren Effekten geführt.
Der auf der britischen Insel entstandene Starmerbot (Version 62.7) ist für seine Fähigkeiten zur Emulation sozialdemokratischer Rhetorik bekannt. In seinem Readme ist zwar mehrfach von sozialer Kompetenz die Rede, seine „Real World“-Performanz in diesem Bereich aber ausgesprochen gering. Er entspricht weitgehend der Vorgängersoftware Blairbot, die schlussendlich nach stark zurückgegangenen Verkaufszahlen eingestellt werden musste.
Der Baerbot ist ein besonders leistungsarmes jüngeres Phänomen und wurde auf den meisten Installationen nach ersten enttäuschenden Tests gelöscht. Dem Vernehmen nach installierte sich die Software ungefragt auf den Rechnern der Vereinten Nationen und wurde aufgrund der wiederholt angezeigten ukrainischen Nationalfarben für einen Bildschirmschoner gehalten – eine Funktion, mit der er den Hostcomputer dann jedoch aufgrund zahlreicher fehlerhafter Routinen zum Erliegen brachte. Eine tragische Entwicklung eines kaum bekannten Herstellers aus Deutschland. Unser Tipp nach einwöchigem Test von Version 44.4 ist die schnellstmögliche Deinstallation.
Der Bibibot (Version 75.6) ist eine gefährliche Malware: mit seiner stets aktiven Wiper-Erweiterung zerstört er bevorzugt arabische Systeme, korrumpierte dabei aber auch sämtliche Entwicklungsumgebungen seines israelischen Herstellers und alle angebundenen Netzwerke. Eine baldige Übernahme durch einen US-Konzern ist scheinbar in Planung. Aufgrund seines einseitigen Empathiefaktors ist der Bibibot für den Einsatz im Glücksspiel- und Immobiliensektor prädestiniert. Aber aufgepasst! Sobald ein Host in den Ruhezustand übergeht, schürft er mit gestohlener Rechenleistung Bitcoins zu seinem eigenen Vorteil, was ihm mehrfach den Vorwurf der Bloatware eingebracht hat. Dies führt angesichts seiner einseitigen Nutzungsmöglichkeiten zur fortwährenden Verschwendung vorhandener Ressourcen. In der Klasse der Politbots ist der Bibibot daher als verstohlen verschrien. Wir empfehlen den schnellstmöglichen Einsatz von Antivirensoftware.
Allen untersuchten Bots gemeinsam ist ein Fehlen jeglicher kreativer Einsatzmöglichkeiten und eine über Bodenständigkeit hinausgehende technische Vision. Wie zu erwarten war, sind Politbots nichts anderes als vornehmlich einseitige und meist sogar gänzlich nutzlose Programme.
David Andel