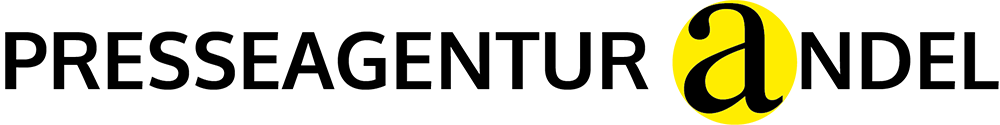Politiker lieben Panik, da verwirrte Wähler ihre Stimme besonders leichtfertig an der Wahlurne abgeben. Wer jedoch Ruhe bewahrt und vielleicht sogar mit dem Entsetzen Scherz treibt, kann durchaus zu dem Schluss kommen, dass Hysterie vor allem den Köpfen jener entspringt, denen konstruktive Lösungen zu viel abverlangt wären. Ein Blick auf ein Kino, das dabei hilft, trotz allem einen kühlen Kopf zu bewahren.
Gelungene cineastische Dramatisierungen über den Atomkrieg gibt es durchaus einige. Die meisten davon sind jedoch schwermütig. Es kann zwar nicht schaden, auch einen Blick auf Werke wie On The Beach (1959, deutscher Titel: Das letzte Ufer) oder The World, the Flesh and the Devil (1959, deutscher Titel: Die Welt, das Fleisch und der Teufel) zu werfen, wenn man glaubt, ein begrenzter Atomkrieg wäre unter Hinnahme einiger weniger Unannehmlichkeiten gar nicht mal so schlecht. Das soll uns aber hier nicht weiter interessieren, denn der Reiz, über all das zu lachen, was Kriegstreiber für uns in einer wehrhafteren und damit bescheuerteren Welt vorgesehen haben, ist sehr viel größer.
The Russians Are Coming the Russians Are Coming (1966)
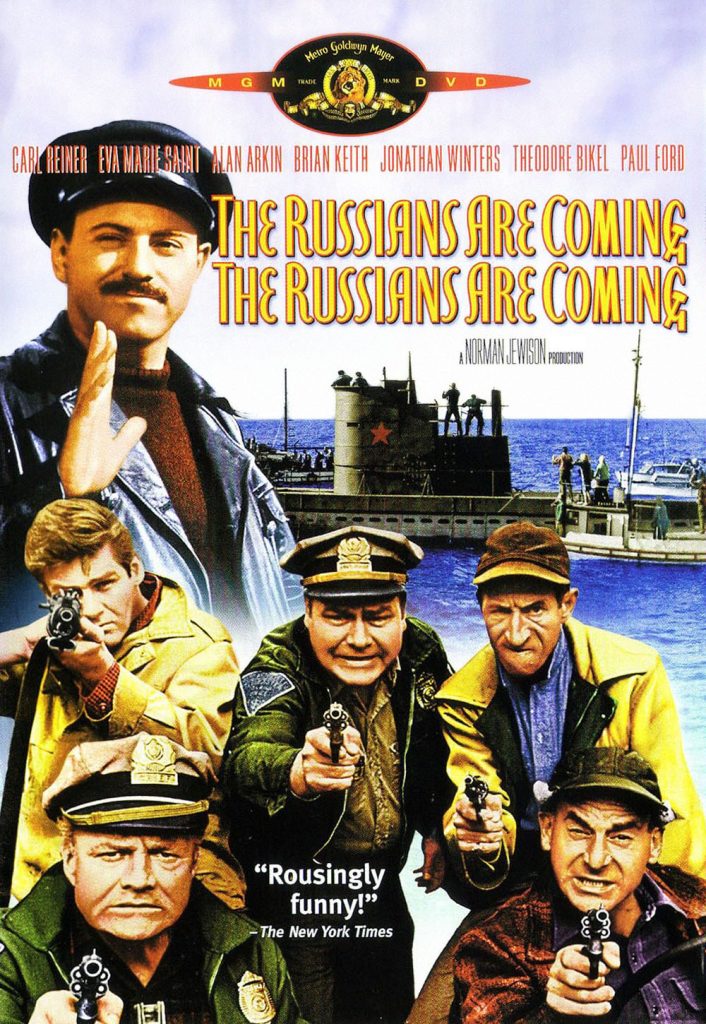
Eine nicht ganz so berauschende Komödie, nichtsdestotrotz aber tauglich, um in die Seele unbedarfter Bürger der USA Einblick zu nehmen, ist The Russians Are Coming the Russians Are Coming (deutscher Titel: Die Russen kommen! Die Russen kommen!) von Norman Jewison, der vor allem bekannt für großartige Kinoerlebnisse wie Send Me No Flowers (1964, deutscher Titel: Schick mir keine Blumen) oder The Thomas Crown Affair (1968, deutscher Titel: Thomas Crown ist nicht zu fassen) war. Zwischen diesen beiden großartigen Leinwandperlen drehte er aber auch jenen Film, in dem die Russen wirklich mal beim schärfsten Gegner vorbeikommen, mit ihrem U-Boot auf einer Sandbank stecken bleiben und dann auf der Suche nach einem rettenden Schlepper auf der Insel Gloucester Island in den USA versacken.
Die Bürger dort verhalten sich genau so, wie man es von US-Amerikanern erwartet und geraten allesamt in Panik. Die sämtlich von falschen Russen verkörperten angeblich echten Sowjets wiederum tun ihr übriges und entsprechen vorbildlich dem damaligen Stereotyp. Kritiker verglichen den albernen Kintopp gern mit der kindlichen Unschuld üblicher Werke aus den britischen Ealing-Studios. Andere wiederum meinten: „Der schwerfällige Produzent und Regisseur des Films, Norman Jewison, hat es zugelassen, dass fast jeder Moment des Films doppelt so bunt, doppelt so laut und doppelt so hektisch wird, wie er sein müsste; das ist umso bedauerlicher, als die Besetzung eine Reihe ausgezeichneter komischer Schauspieler umfasst.“. Für ein doppelt so buntes, doppelt so lautes und doppelt so hektisches Nachmittagsvergnügen ist die vielleicht etwas kindische Produktion aber allemal gut.
The Bed Sitting Room (1968)
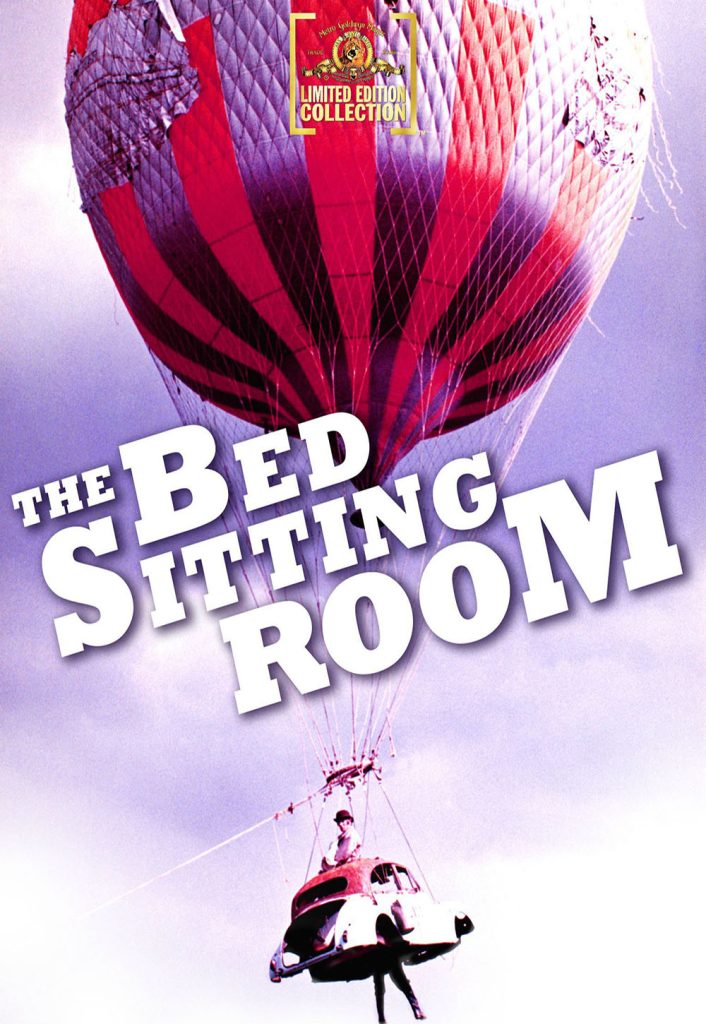
Richard Lesters The Bed Sitting Room (deutscher Titel: Danach) ist da schon von ganz anderem Kaliber. Hier wird völlig verrückt dargestellt, was uns nach einem Atomkrieg erwartet: nur Unerwartetes. Schon der Trailer ist Gold wert. Die Anarchie, die auf der britischen Insel nach einem Atomkrieg entsteht, ist unausweichlich britisch und damit in nicht geringem Maße absurd. Zahlreiche Szenen bleiben nach der ersten Begegnung mit diesem Film für immer haften und helfen vielleicht eines Tages mal darüber hinweg, wenn wir feststellen, dass das Überleben eines Atomkriegs doch nicht ganz so erstrebenswert ist.
I’m forced to ask: Have we forgotten the bomb?
Die große Frage in The Bed Sitting Room (1968)
Der Vorwurf, dass der gesamte Streifen einem sehr langen Monty-Python-Sketch entspricht, ist im vorliegenden Fall als durchaus unausweichlich zu sehen, denn jeder Versuch, dem Sujet etwas anderes als Hoffnungslosigkeit abgewinnen zu wollen, wäre ohnehin zum Scheitern verurteilt, insbesondere der haarsträubende Schwachsinn namens The Day After (deutscher Titel: The Day After – Der Tag danach) bleibt unvergessen. Die Zahl der Witze in The Bed Sitting Room hält der Länge des Films nicht ganz stand, sodass manche Wiederholungen zu ertragen sind und der Eindruck entsteht, dass das Projekt seine Macher in ähnlichem Maße überforderte, wie Politiker es im Allgemeinen von der Kriegsführung sind. Der Hauptunterschied ist das Lachen – oder nicht?
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
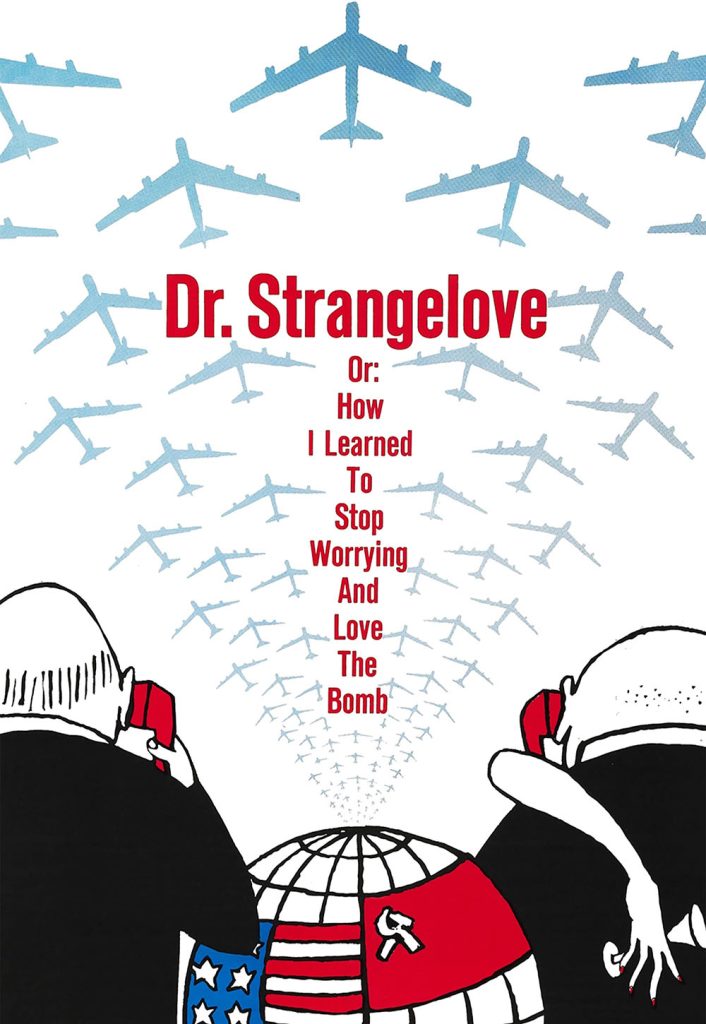
Peter Sellers musste erst Stanley Kubrick in Lolita (1962) begegnen, damit sein ganzes Talent im Folgewerk voll zur Geltung kam. Zuvor nahm man ihm den Komödianten zwar ab, in Kubricks Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (deutscher Titel: Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben) erzielte sein Spiel jedoch das Niveau eines Alec Guiness, mit dem Sellers neun Jahre früher allzu schüchtern in The Ladykillers (1955) spielte.
Geschildert wird in Kubricks einziger Komödie das Ausrasten eines Militärs, in dessen Befehlsfolge die ganze Zivilisation nach und nach baden geht. Sellers verkörpert darin nicht weniger als drei tragende Rollen. Neben der Darstellung des britischen Group Captain Lionel Mandrake, dem es aufgrund seines britischen Understatements partout nicht gelingen will, den kriegsgeilen Brigadegeneral Jack D. Ripper (der Name ist Programm) zurück auf den Pfad des Gehorsams zu holen ist das die Rolle des US-Präsidenten Merkin Muffley, dem beschwichtigend unweigerlich alles folgenschwer entgleitet. Den Vogel schießt aber der zwielichtige Dr. Strangelove ab, der uns an so viele Kriegstreiber der letzten Jahre (und überhaupt) erinnert und der bei gleichzeitigem Kontrollverlust über seinen eigenen Körper den Traum künftiger Übermenschen träumt.
Den von Sterling Hayden perfekt gegebenen napoleonischen Wassernarren Ripper darf der geneigte Zuschauer genauso fassungslos dabei zusehen, wie er die Welt in den Untergang stürzt, wie denjenigen, die uns nun immer wieder predigen, ein kleiner Weltkrieg wäre gar nicht mal so schlimm und den Drohungen des mit wertewestlicher Inbrunst in die Enge getriebenen Russlands solle man getrost keinen Glauben schenken. Immerhin enden all diese Filme nach 125, 91 oder 94 Minuten und der geneigte Zuschauer darf sich dann wieder der weniger amüsanten Routine des Alltags widmen, der für viele Menschen außerhalb der zunehmend großen Krisengebiete noch einigermaßen friedlich verläuft.
David Andel